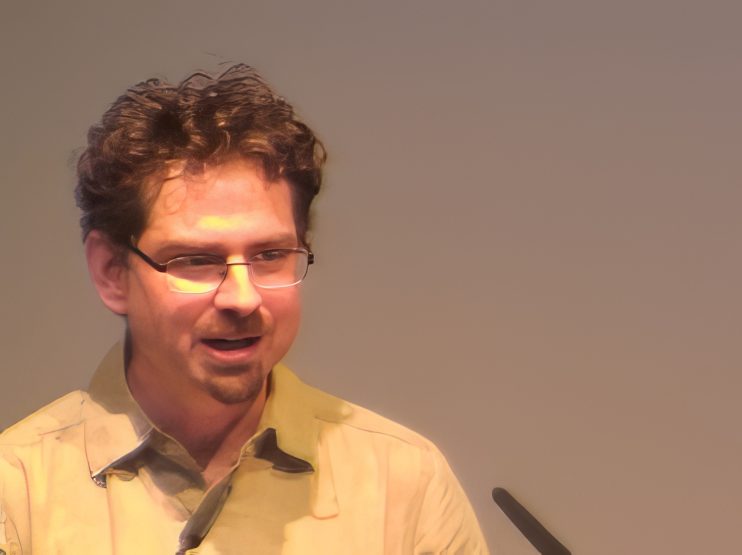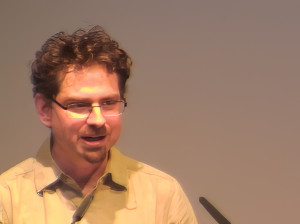Der Philosoph Daniel Saudek fragt, warum die sozial-ökologische Wende der reichen Gesellschaften trotz der sich drastisch verschärfenden Probleme wie Ungleichheit, Klimakrise und Artensterben ausbleibt. Er konkretisiert die Frage zudem auf die Rolle, welche die Kirche bisher gespielt hat und künftig spielen sollte.
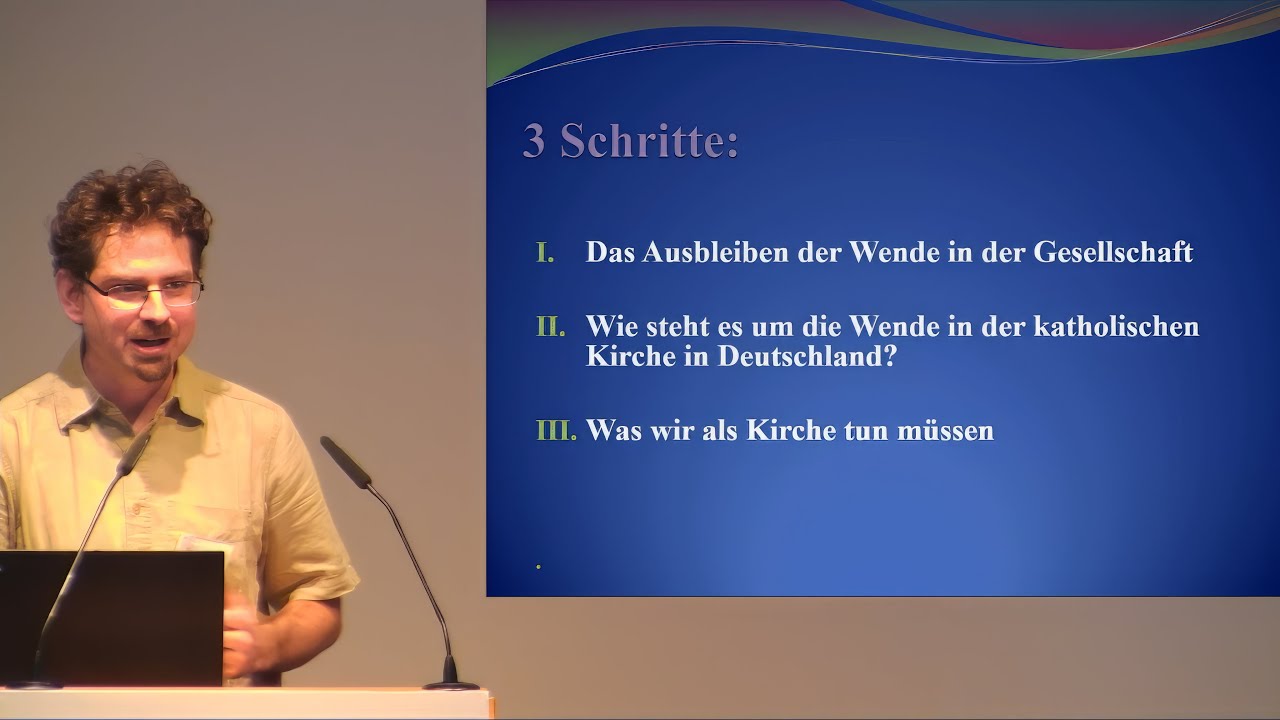
Zusammenfassung
Das Ausbleiben der sozialökologischen Wende in der Gesellschaft
Das Grundproblem ist der Raub der Lebensgrundlagen durch die Lebensstile der reichen Welt, das sind ungefähr 20-25% der Menschheit. Die Ursachen dafür sind unfaire Handelspraktiken, zu hohe ökologische Fußabdrücke durch übermäßigen Konsum, Automobilität, Flugreisen, Fleischkonsum etc. Die Folgen davon sind Flucht, Missernten und Artensterben durch die Klimakrise. Dies verletzt die Menschenrechte und ist mit Demokratie und Rechtsstaat nicht vereinbar. Es besteht die Pflicht zu menschenrechtskompatiblen, nachhaltigen Lebensstilen.
Die sozialökologische Wende in der katholischen Kirche Deutschlands
Positiv ist der Einsatz von Fairtrade-Kaffee bei Veranstaltungen. Negativ sind die übermäßige Automobilität und Flugreisen, die fehlende Thematisierung des Unrechts dieser Lebensstile in der Verkündigung, die Ablehnung der katholischen Soziallehre durch rechte Kreise und die mangelnde Ausbildung in Hochschulen. Das Fazit ist, dass wesentliche Missstände bezüglich des Schutzes der Lebensgrundlagen nicht korrigiert werden.
Was die Kirche tun muss
Die Kirche muss sich selbst zu menschenrechtskompatiblen Lebensstilen verpflichten, klare Regeln und Grenzen wie dienstliche Flugreisen einführen, unrechte Lebensstile in der Verkündung benennen, rechte Strömungen zurückweisen und sozial-ökologische Themen in der Ausbildung verankern. Die Kirche muss die Missstände korrigieren und selbst mit gutem Beispiel vorangehen, um ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden.
Weitere Beiträge der Tagung
Der Vortrag des Philosophen Tobias Müller plädiert zwar für eine Sonderstellung des Menschen, aber ohne Anthropozentrismus.
Die "deep incarnation" sieht Gott nicht nur in Jesus, sondern in aller Materie inkarniert. Die Theologin Julia Enxing argumentiert damit für eine Abkehr vom anthropozentrischen Paradigma hin zu einem neuen Verständnis der Beziehungen zwischen Mensch, Tier und Natur.
Der Philosoph Hans-Dieter Mutschler setzt sich mit Argumenten gegen die Sonderstellung des Menschen auseinander. Ein Argument schließt aus der Kontinuität: Insofern die Evolution kontinuierlich bis zum Menschen verlaufe, könne dieser nichts Besonderes sein. Nun weist Mutschler nach, dass sich Kontinuität und Diskontinuität, und damit die Sonderstellung, nicht ausschließen.
Georg Gasser gibt zunächst eine Einführung in den Transhumanismus und dessen Idee der technologischen Überwindung menschlicher Grenzen inkl. des Mind-Uploading. Anschließend diskutiert Gasser drei Kritikpunkte an dieser Sichtweise.
Suzann-Viola Renninger, Philosophin und Mitglied der Zürcher Tierversuchskommission, berichtet, wie der Begriff der "Würde der Kreatur" 1992 in die Schweizer Verfassung aufgenommen wurde und wie sich dies im konkreten Umgang mit Tieren auswirkt.
Projektvorstellungen
Das Dissertationsprojekt Benjamin Litwins fragt nach genmodifiziertem Dis-Enhancement von Nutztieren, bei dem Eigenschaften (z. B. Schmerzempfingungen) genommen werden und bei dem das bisherige Tierwohl-Konzept an die Grenzen kommt.
Die Dissertation von Ivo Frankenreiter beschäftigt sich mit der Notwendigkeit einer ökologischen und sozialen Transformation. Der Fokus ethischer Reflexion verschiebt sich dabei von Fragen der Begründung auf solche der Umsetzung.
Lorns-Olaf Stahlberg geht es um das Selbstverständnis des Menschen, die Welt zu beherrschen, zu gestalten und jetzt auch zu retten.
Bei der Vorstellung ihres Dissertationsprojektes setzt Johanna Häusler damit an, dass libertarische Theorien Freiheit als inkompatible mit Determinismus ansehen.
Der Philosoph Daniel Saudek fragt, warum die sozial-ökologische Wende der reichen Gesellschaften trotz der sich drastisch verschärfenden Probleme wie Ungleichheit, Klimakrise und Artensterben ausbleibt und welche Rolle die Kirche bisher gespielt hat und künftig spielen sollte.