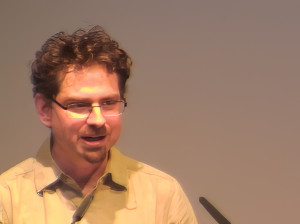Die projektierte moraltheologische Dissertation des Theologen Benjamin Litwin fragt danach, ob neuartige genmodifizierte Nutztiere entwickelt werden sollen, die “besser” an die bestehenden Haltungsbedingungen der industriellen Landwirtschaft angepasst sind? Die Befürworter:innen wollen durch den Einsatz von CRISPR/Cas u. ä. das Wohlergehen des Tieres steigern, nicht nur durch Enhancement, sondern auch durch das sogenannte Dis-Enhancement. Hierbei sollen den Tieren Eigenschaften / Fähigkeiten (wie etwa die Schmerzempfindung) “genommen” werden.

Entfaltung
Die Gentechnik bei Tieren ist ein relativ neues Thema für die theologische Ethik, weshalb sich Litwin zunächst an Philosophen orientiert. Seine Aufgabe wird es in der Doktorarbeit sein, die Brücke zur Theologie zu schlagen.
Litwin erläutert kurz die Vorteile der CRISPR-Cas-Technologie gegenüber früheren Verfahren des Genome Editings. Sie ist kostengünstiger, präziser und effizienter. Anschließend geht er auf mögliche Anwendungsbereiche ein. Er konzentriert sich in seiner Arbeit auf die Nutztierhaltung und mögliche Verbesserungen für das Tierwohl.
In der Nutztierhaltung sieht Litwin zwei problematische Aspekte: Züchtungen, die zu Leid führen, sowie Haltungsbedingungen, die Stereotypien auslösen. Typische Eingriffe wie das Kupieren von Schnäbeln könnten durch Genom-Editing überflüssig gemacht werden. Anschließend erläutert er konkrete Beispiele für genetische Veränderungen, die er als Enhancement oder Disenhancement bezeichnet. Litwin versteht unter Disenhancement genetische Veränderungen bei Tieren, durch die bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten entfernt oder reduziert werden, z. B.:
- Tiere ohne Hörner
- Federlose Hühner, die man nicht mehr rupfen muss
- Blinde Hühner, die ihre bedrängte Umgebung nicht mehr wahrnehmen
Im Gegensatz dazu versteht er unter Enhancement genetische Veränderungen, durch die dem Tier neue Eigenschaften oder Fähigkeiten hinzugefügt werden, die es an die Haltungsbedingungen anpassen. Zum Beispiel Krankheitsresistenzen bei Kühen.
Laut Litwin wird in der Forschung nicht klar zwischen Enhancement und Disenhancement unterschieden. Er sieht aber einen deutlichen Unterschied darin, ob dem Tier etwas hinzugefügt wird oder etwas weggenommen wird.
Das etablierte Tierwohlkonzept scheint auf eine Bewertung dieser neuen Möglichkeiten kriteriologisch noch nicht hinreichend vorbereitet zu sein. So bleibt für viele eine negative Intuition, dass etwas moralisch falsch sein könnte, ohne dass diese Intuition angemessen begrifflich fassbar wäre.
Weitere Beiträge der Tagung
Der Vortrag des Philosophen Tobias Müller plädiert zwar für eine Sonderstellung des Menschen, aber ohne Anthropozentrismus.
Die "deep incarnation" sieht Gott nicht nur in Jesus, sondern in aller Materie inkarniert. Die Theologin Julia Enxing argumentiert damit für eine Abkehr vom anthropozentrischen Paradigma hin zu einem neuen Verständnis der Beziehungen zwischen Mensch, Tier und Natur.
Der Philosoph Hans-Dieter Mutschler setzt sich mit Argumenten gegen die Sonderstellung des Menschen auseinander. Ein Argument schließt aus der Kontinuität: Insofern die Evolution kontinuierlich bis zum Menschen verlaufe, könne dieser nichts Besonderes sein. Nun weist Mutschler nach, dass sich Kontinuität und Diskontinuität, und damit die Sonderstellung, nicht ausschließen.
Georg Gasser gibt zunächst eine Einführung in den Transhumanismus und dessen Idee der technologischen Überwindung menschlicher Grenzen inkl. des Mind-Uploading. Anschließend diskutiert Gasser drei Kritikpunkte an dieser Sichtweise.
Suzann-Viola Renninger, Philosophin und Mitglied der Zürcher Tierversuchskommission, berichtet, wie der Begriff der "Würde der Kreatur" 1992 in die Schweizer Verfassung aufgenommen wurde und wie sich dies im konkreten Umgang mit Tieren auswirkt.
Projektvorstellungen
Das Dissertationsprojekt Benjamin Litwins fragt nach genmodifiziertem Dis-Enhancement von Nutztieren, bei dem Eigenschaften (z. B. Schmerzempfingungen) genommen werden und bei dem das bisherige Tierwohl-Konzept an die Grenzen kommt.
Die Dissertation von Ivo Frankenreiter beschäftigt sich mit der Notwendigkeit einer ökologischen und sozialen Transformation. Der Fokus ethischer Reflexion verschiebt sich dabei von Fragen der Begründung auf solche der Umsetzung.
Lorns-Olaf Stahlberg geht es um das Selbstverständnis des Menschen, die Welt zu beherrschen, zu gestalten und jetzt auch zu retten.
Bei der Vorstellung ihres Dissertationsprojektes setzt Johanna Häusler damit an, dass libertarische Theorien Freiheit als inkompatible mit Determinismus ansehen.
Der Philosoph Daniel Saudek fragt, warum die sozial-ökologische Wende der reichen Gesellschaften trotz der sich drastisch verschärfenden Probleme wie Ungleichheit, Klimakrise und Artensterben ausbleibt und welche Rolle die Kirche bisher gespielt hat und künftig spielen sollte.